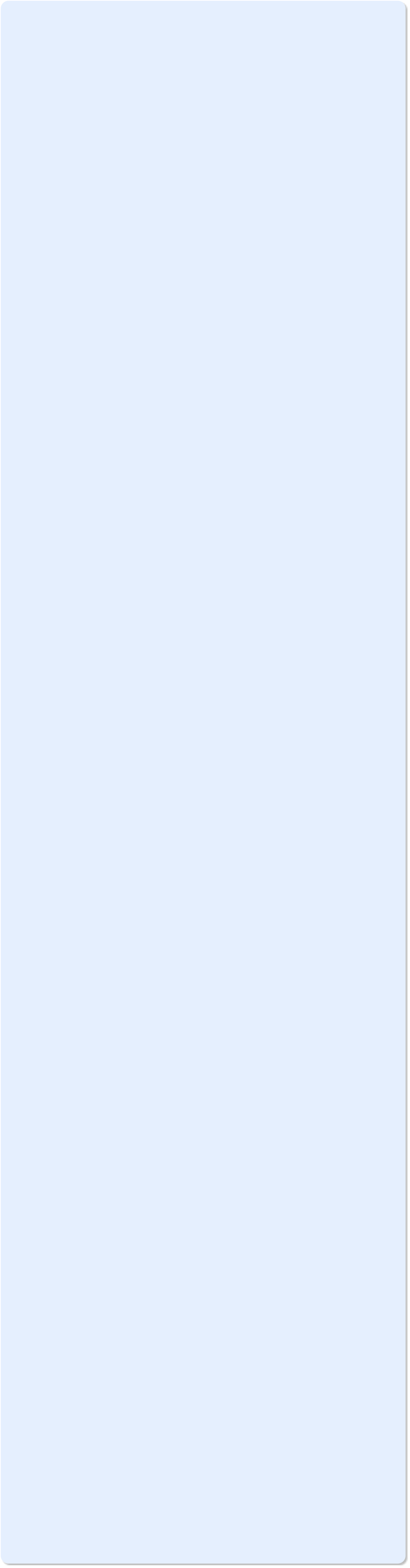
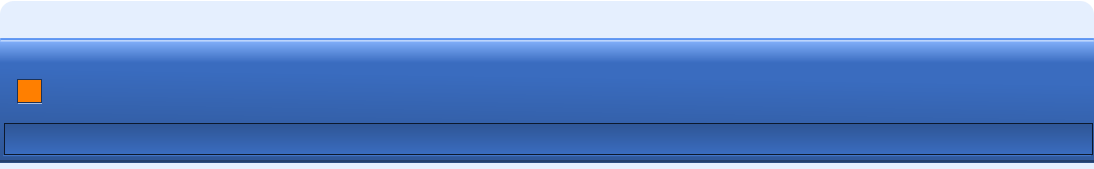

Christian Hartung - Pfarrer und Schriftsteller
"Der goldene Bogen" richtet sich an Leser ab ca. 12 Jahren. Sein Thema ist die erforderliche Zivilcourage angesichts von erstarkendem
Rechtsradikalismus (der auch unter jüngeren Schülern wirbt), Antijudaismus und Fremdenfeindlichkeit. Aus der Erkenntnis heraus, dass
man diese Zivilcourage nicht findet, wenn man gebannt auf die Bedrohung starrt, sucht das Buch eine erzählerische Lösung, die dem Mut
die Fantasie zur Seite stellt.
Die Geschichte spielt in der realen und zugleich in einer fantastischen Welt. Anders als bei Fantasybüchern, in denen der Held die fremde
Welt retten muss und dort sagenhafte Gestalten als Freund und Feind kennenlernt, ist es hier unsere eigene Welt, die "gerettet" werden
müsste, wenn dies so einfach ginge. Die andere Realität gehorcht denselben Gesetzen wie unsere und dient den Figuren
sozusagen als doppelter Boden; sie gewinnen dadurch Handlungsmöglichkeiten, Perspektiven und Verbündete, die sie sonst nicht
bekommen hätten.
Die Hauptperson ist der vierzehnjährige Jotam Kanowski. Er lebt am Rand einer fiktiven größeren deutschen Stadt namens Domburg mit
seinen Eltern und dem achtzehnjährigen Bruder Jonathan und wächst sehr behütet auf. An einem Winternachmittag ist er mit dem Fahrrad
unterwegs und befindet sich plötzlich in einer ihm völlig fremden Welt auf dem Rücken eines Pferdes. Eigentlich kann er gar nicht
reiten – in dieser fremden Welt kann er es. Er hat lückenlose Erinnerungen an die vierzehn Jahre, die er hier gelebt hat: als jüngstes Kind
der Königin von Kengarlin, einem Land auf der Insel Kenrhin, die völlig abgelegen in einem großen Ozean liegt. Eine riesige Flotte unter
dem Kommando von Rellek aus dem fernen Land Ranírzan hat schon benachbarte Inselreiche verwüstet und nähert sich Kenrhin. Jotam
gelingt die Flucht aus einer von Rellek zerbombten Stadt übers Meer.
Er lebt in beiden Welten parallel, kann den Wechsel dazwischen jedoch nicht beeinflussen. Er gewinnt allmählich in beiden Welten
Freunde, lernt jedoch auch in beiden Welten die gleichen Feinde kennen und hat den Verdacht, Rellek und sein verhasster
Mathematiklehrer Herr Keller seien dieselbe Person. In Kenrhin gelingt ihm unter abenteuerlichen Umständen die weitere Flucht vor
Rellek. Dabei weckt er den Menschen, denen er begegnet, Hoffnung durch den goldenen Bogen, den er als Prinz von Kengarlin an
einer Kette um den Hals trägt.
Christian Hartung: "Der goldene Bogen. Band 1: Der Prinz von Kengarlin"
Kontrast Verlag Pfalzfeld/Hunsrück, 2009
ISBN: 978-3-941200-11-1
LESEPROBE:
Es war plötzlich still im Zelt geworden. Ein sehr alter Mann saß vor Mitan und sprach leise mit ihm. Dabei schaute er immer wieder zu mir
herüber. Mitan nickte und stand auf.
Der Alte trat vor mich und legte mir die Hände auf die Schultern. „Es ist eine große Ehre für uns, dass du unser Gast bist, Prinz Jotam!“,
sprach er feierlich. „Wenn du jetzt zu deiner Mutter gehst, der Königin von Kengarlin, dann soll sie wissen, dass wir uns in der Stunde der
Not ihrem Befehl unterstellen, bis unser König wieder seinen Platz im Schloss in Doranan einnehmen kann. Du trägst ihr Zeichen. Bei
diesem Zeichen schwören wir, dass wir gegen den Feind zusammenstehen, der uns plötzlich überfallen hat. Die Königin in Garmon kann
über uns verfügen, bis wir wieder unsere eigenen Herren sind.“
Er legte seine rechte Hand auf den goldenen Bogen an meiner Kette, schloss die Augen, murmelte etwas und führte die Hand dann an
seine Stirn. Ebenso taten es alle anderen im Zelt – und auch von draußen kamen sie herein. Ich fühlte mich erst unwohl angesichts dieser
vielen Männer, Frauen und sogar Kinder, die murmelnd meine Kette und ihre Stirn berührten und dann dem Nächsten Platz machten.
Zugleich verschwand jedoch meine Müdigkeit – und schließlich war es so, als ob jeder der vielen Menschen mir ein wenig von seiner Kraft
abgäbe.
Ich wusste erst nicht recht, wie ich darauf antworten sollte. Doch die Kette verpflichtete ja zu allererst mich selbst, der sie trug. Sie war jetzt
meine Verbindung zu meiner Mutter und zu meinen Schwestern und meinem Vater, zu Astan und Endilya und überhaupt allen – ja, selbst
zu Eskan. Ich legte meine Hand auf den goldenen Bogen, den so viele Hände berührt hatten, verbeugte mich vor dem alten Mann und
sagte: „Ich danke euch. Jetzt gehören wir alle zusammen. Jetzt habe ich keine Angst mehr!“
Doch – ich hatte Angst. Sehr große sogar. Denn ich stand nicht mehr in dem Zelt im Flüchtlingslager auf Tona, sondern saß in einer
Domburger Straßenbahn. Neben mir saß Nadine.
Wir kamen von der Lokalredaktion; und natürlich fuhren wir nicht auf dem kürzesten Weg nach Hause, sondern machten noch einen
Abstecher zu dem Vorort, in dem sie Eskan umgebracht hatten.
Nadine hatte ihre kleine Digitalkamera mit; wir sagten einander, dass es ja nichts schaden könne, ein paar „authentische“ Fotos zu haben –
der Ausdruck kam von Nadine –, und wussten beide, dass es uns nicht nur um die Fotos ging. Viktor war nicht mitgekommen, die
Redaktion war ihm tatsächlich zu langweilig gewesen. Doch jetzt wäre ich froh gewesen, ihn dabei zu haben. Die einzigen Fahrgäste im
Wagen außer uns waren ein dunkelhäutiger Mann und vier junge Kerle, die sich vor ihm aufgebaut hatten und ihn anpöbelten. Der
Schwarze redete mit beschwichtigenden Handbewegungen auf die anderen ein; er sprach Englisch und der Wortführer der vier
schnauzte: „Eh, Nigger, wir sind hier in Deutschland! Hier wird Deutsch gesprochen! Alles klar?“
Der Afrikaner lächelte, hob wieder beschwichtigend die Hände und sagte, mit Akzent, aber immerhin auf Deutsch: „Alles klar!“
Das passte dem anderen anscheinend genauso wenig. Er schnauzte wieder: „Was soll das denn sein? Soll das etwa Deutsch sein? Eh,
Nigger, am besten hältst du einfach die Schnauze! Das klingt sonst ja widerlich!“
Die Straßenbahn hielt an einer Haltestelle. Der Afrikaner stand auf und sagte, immer noch lächelnd, aber wieder auf Englisch, dass er
hier aussteigen müsse.
Er wurde jedoch zurück auf den Sitz geschubst und angeschrien: „Was soll das denn: einfach abhauen ohne ‘Auf Wiedersehen’ zu
sagen? Wir sind hier nicht bei dir zu Hause im Busch!“
Die Straßenbahn fuhr wieder an. Ein älteres Ehepaar, das an der Haltestelle gewartet und gesehen hatte, wie der Schwarze am
Aussteigen gehindert wurde, stieg in einen anderen Wagen, obwohl unserer näher gestanden hätte.
Inzwischen lächelte der Afrikaner nicht mehr, sondern blutete aus der Nase, weil sie ihn mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen hatten,
als er noch einmal versucht hatte aufzustehen. Er hielt sich ein Papiertaschentuch vor seine blutende Nase.
Einer der Kerle, der eine offene Bierflasche in der Hand hielt, kippte ihm etwas daraus über den Kopf und rief: „Suchst du was zum
Putzen, Nigger? Hier!“
Begeistert grölten die anderen: „Ja, wasch dich mal! Wie läufst du eigentlich rum!“
Zitternd vor Anspannung und Angst war ich aufgestanden, ohne es recht zu merken. Ich suchte etwas an meinem Hals, doch da war kein
goldener Bogen, sondern nur der Reißverschluss meiner Jacke. Ich hatte nichts, woran ich mich festhalten konnte. Nichts, was die
Spannung in mir auflösen konnte. Da hörte ich mich rufen: „Aufhören!“ Es wurde still im Wagen. Leiser und mit zitternder Stimme setzte
ich hinzu: „Hört sofort auf! Bitte!“
Das letzte Wort schien die Schläger so zu amüsieren, dass sie von ihrem Opfer abließen und stattdessen zu uns herüberkamen. Nadine
zog mich auf den Sitz zurück und zischte mir etwas zu.
Der Anführer der Gruppe baute sich höhnisch grinsend vor mir auf. Er war groß und ziemlich dick und schaffte es, dass ich mich vor ihm
ganz winzig fühlte. „Habt ihr gehört?“, fragte er seine Kameraden. „Er hat sogar ‘bitte’ gesagt! Das ist aber ein gut erzogener Junge! Bist
ein gut erzogener Junge, was? Ja, aber eins haben dir deine Eltern nicht beigebracht, gut erzogener Junge: den Unterschied zwischen
einem anständigen Deutschen und einem schmutzigen Nigger! Du bist doch nicht etwa ein Niggerfreund, gut erzogener Junge? He?“
Ich wusste nicht, ob es klüger war, zu schweigen oder irgendetwas zu sagen.
Doch er redete schon weiter: „Ich bin nämlich auch ein gut erzogener Junge! Doch, ja, das bin ich! Glaubt ihr mir etwa nicht?“ Er lachte
brüllend und seine Kameraden grölten: „Wir sind alle gut erzogene Jungs!“
Die Straßenbahn hielt wieder. Der Schwarze rannte nach draußen.
„He!“, schrie einer der Burschen. „Der Kaffer rennt weg und hat immer noch nicht ‘Auf Wiedersehen’ gesagt!“
Der Anführer, der breitbeinig und mit den Daumen im Gürtel vor mir stand, warf nur einen kurzen Blick über seine Schulter. „Lass ihn
laufen, den heben wir uns für ein andermal auf!“ Dann wandte er sich wieder mir zu, mit geradezu genüsslichem Grinsen. „Siehst du, mit
so etwas lässt man sich einfach nicht ein! Hast du das verstanden, gut erzogener Junge?“ Und als ich nicht antwortete, brüllte er: „He,
ich rede mit dir! Ich glaube, so gut erzogen bist du doch nicht! Ob du verstanden hast, hab ich gefragt!“
Ich murmelte: „Ja.“
„Was war das denn?! So antwortet aber kein gut erzogener Junge! – Wie heißt das?“, fragte er einen seiner Kameraden über die
Schulter und der antwortete grinsend: „Das heißt: Ja, mein Führer, ich habe verstanden!“
„Siehst du, so heißt das! Also, hast du verstanden? He? Hast du verstanden?“
Die Straßenbahn hielt an der nächsten Haltestelle – und wieder stiegen Leute, die hier gewartet hatten, woanders ein. Die Bahn fuhr
wieder an.
Der Breitbeinige bemerkte meinen Blick und sagte: „Ach, ihr müsst hier aussteigen? Ja, das hättest du mir sagen müssen, gut erzogener
Junge! Wir halten dich ja nicht auf, dich und deine nette Freundin! Ihr könnt gehen! Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt! Aber es gehört sich
doch einfach, dass man vorher auf eine höfliche Frage eine höfliche Antwort gibt, nicht wahr? Also?“
„Sag’s endlich!“, bat Nadine mit gepresster Stimme und mein Gegenüber bekam einen entzückten Gesichtsausdruck.
„Na, schau mal, sogar deine kleine Freundin weiß, was sich gehört! Also, gut erzogener Junge – ich möchte euch ja nicht gerne länger
aufhalten, ich möchte nur wissen, ob du mich verstanden hast?“
Er hielt sein Gesicht dicht vor meins und setzte ein süßes Lächeln auf.
Ich wusste, dass er uns erst gehen lassen würde, wenn er seinen Willen bekommen hatte, atmete tief durch und sagte laut und deutlich:
„Ja, mein Führer, ich habe verstanden!“
Sein Gesicht bekam wieder diesen verzückten Ausdruck. „Ja“, sagte er. „Ja. So ist es recht. Na, siehst du. Warum denn nicht gleich! –
Bitte sehr! Ihr dürft gehen! Niemand hindert euch! – Na, wollt ihr denn nicht aufstehen? Man könnte ja fast den Eindruck bekommen, es
hindert euch jemand daran!“
Ich stand auf und ging zur Mitte des Wagens, Nadine folgte mir rasch. Ich wusste nicht, wo wir waren, doch ich würde an der nächsten
Haltestelle aussteigen. Die vier beobachteten uns und machten sich über uns lustig. Dann kam endlich die Haltestelle. Nadine und ich
stolperten nach draußen. Ich schaute mich um: Die Häuser sahen so aus wie auf dem Zeitungsfoto. Ein Stück weiter die Straße entlang
war auch eine Bushaltestelle. – Es konnte dieselbe sein, die in der Zeitung abgebildet war.
„Können wir euch vielleicht weiterhelfen?“ Ich fuhr herum. Natürlich hätte ich mir denken können, dass die vier ebenfalls aussteigen
würden. Wahrscheinlich wohnten sie sogar hier. Die Straßenbahn fuhr weiter.
„Nein, danke“, antwortete ich und fügte rasch hinzu: „Mein Führer“, als er sein Gesicht fragend schräg stellte und die Augenbrauen
hochzog.
„Wir sind zu weit gefahren. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Wir nehmen die nächste Bahn zurück.“
„Ach, das ist aber schade! Aber ihr wollt doch gewiss nicht behaupten, das sei unsere Schuld, oder?“
Ich schüttelte schnell den Kopf: „Nein. – Mein Führer.“
„Wessen Schuld ist es denn dann?“
„Unsere eigene. – Meine.“ Immer noch schaute er mich fragend an und ich beeilte mich zu sagen: „Mein Führer.“
Doch er war offenbar noch nicht zufrieden. „Da war nicht zufällig ein ...?“ Ich verstand nicht und er schaute sich wieder über die
Schulter nach einem Kameraden um, der jedoch ebenfalls nicht verstand. Der Anführer seufzte und sagte: „Na ja, wir hatten da doch eben
so eine kleine Unterhaltung, an der du dich beteiligen wolltest. Weißt du das schon gar nicht mehr? Was war der Mann, mit dem wir uns
unterhalten haben, denn für einer?“
Es ging noch eine Weile so weiter, bis ich ihn mit den Worten „Ein Nigger, mein Führer!“ zufriedengestellt hatte. Wenige Minuten später
saßen wir endlich in der Straßenbahn, die zurück in die Stadt fuhr.
Ob das Eskans Mörder gewesen waren? Ich hatte sie mir als brutale Schläger vorgestellt. – Doch dieser große, dicke Kerl, der sich
„Führer“ nennen ließ, war schlimmer als alles, was ich mir vorgestellt hatte. Er hatte mich nicht einmal angefasst und doch bewirkt, dass
ich mich selbst verachtete – ja, mich vor mir selbst ekelte wie vor einem hässlichen, schleimigen Tier. Fast wäre es mir lieber gewesen,
ich hätte auch eine blutende Nase und Bier im Haar gehabt. Zwar hatte ich möglicherweise den Schwarzen vor Schlimmerem bewahrt –
doch selbst das nicht, weil ich so mutig gewesen wäre, sondern weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten hatte.
„Wir müssen hier raus“, sagte Nadine mit tonloser Stimme und stand auf, ohne mich anzuschauen.
Nadines Verachtung bekam ich also noch obendrauf. Sie brauchte mir nichts zu sagen –, ich wusste auch so, dass sie mir alleine die
Verantwortung in die Schuhe schob. Dabei war sie es gewesen, die „authentische“ Fotos haben wollte! Aber es war schon richtig:
Ohne mich wäre sie gar nicht auf die Idee gekommen. Und ich war darauf nur gekommen, weil ich gehofft hatte, mehr über Eskan zu
erfahren. Eigentlich nicht einmal wirklich über Eskan, sondern nur über mich selbst. Über mich und mein verrücktes Doppelleben.
Jetzt hatte ich mehr über mich erfahren, als ich hatte wissen wollen. Allerdings hatte ich auch etwas über Nadine erfahren. Ich konnte
ihr keine Vorwürfe machen – doch ich hatte jedes Interesse an ihr verloren. Viktor passte sicher besser zu ihr. Ich wusste, dass ich zwar
einerseits alles falsch gemacht, aber irgendwie zugleich das Richtige getan hatte.
























